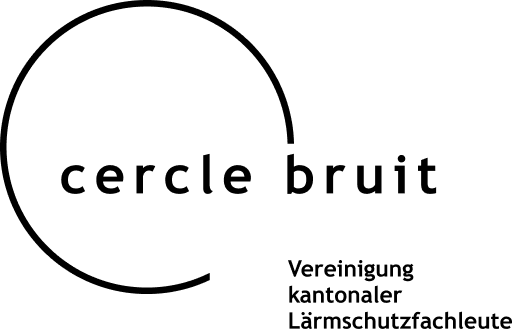Lärm kostet nicht nur Nerven, Lärm kostet auch Geld: indirekt in Form von Gesundheitskosten und Mieteinbussen, direkt als Kosten für Lärmbekämpfungsmassnahmen. Der Strassen- und Schienenverkehr sind die Hauptverursacher des Lärms. Die indirekten, also die externen Lärmkosten des Strassen- und Schienenverkehrs in der Schweiz belaufen sich jährlich auf knapp eine Milliarde Franken. Für Lärmsanierungen werden hingegen nur rund 160 Millionen Franken pro Jahr aufgewendet. Diese werden hauptsächlich für Lärmschutzwände oder den Einbau von Schallschutzfenstern eingesetzt.
Medienmitteilung
Medienmitteilung EKBL
Studien haben gezeigt, dass Lautstärken ab rund 60 Dezibel tagsüber und ab 50 Dezibel nachts vom grössten Teil der Bevölkerung als störend und somit als Lärm empfunden werden. Das Lärmempfinden hängt aber auch von der persönlichen Wahrnehmung ab. Nicht alle Menschen empfinden denselben Lärm als gleich störend. Auch die Art des Lärms, die Tageszeit und der vorherrschende Hintergrundlärm spielen eine wichtige Rolle. Lärm stört aber nicht nur, er verursacht auch volkswirtschaftliche Kosten. So kann Lärm beispielsweise den Wert von Immobilien reduzieren und es entstehen Kosten für die Behandlung von lärmbedingten Gesundheitsschäden. Es entstehen externe Kosten. Als externe Kosten wird jener Teil der Kosten bezeichnet, der nicht von den Verursachenden, sondern von Dritten – respektive der Allgemeinheit – getragen wird.
Die Lärmbelastung wird durch die Verkehrsteilnehmenden verursacht, belastet aber die Anwohnerinnen und Anwohner. Die externen Lärmkosten des Strassen- und Schienenverkehrs werden auf 998 Millionen Franken pro Jahr geschätzt, das entspricht zirka 140 Franken pro Kopf. Davon entfallen knapp 90 Prozent auf Wertverluste von Liegenschaften und rund 10 Prozent auf Kosten im Gesundheitswesen. Nicht berücksichtigt in diesen Zahlen sind die externen Kosten des Flugverkehrs, die Lärmfluchtkosten – Wohnen und Freizeit im Grünen – sowie die geringere Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz und in der Schule wegen Konzentrationsschwierigkeiten.
Laute Wohnungen sind weniger attraktiv
Lärm als Wertvernichter von Immobilien wurde erst mit der Fluglärmproblematik zu einem viel beachteten Thema. Dabei wohnen in der Schweiz Hunderttausende von Menschen an lärmigen Verkehrswegen. Diese Immobilien verlieren durch den Lärm an Wert. Belärmte Wohnungen werden weniger nachgefragt als vergleichbare Wohnungen in ruhigeren Gebieten. Diese Mindernachfrage schlägt sich in einem tieferen Mietpreis nieder. Gemäss unterschiedlichen Schätzungen nimmt der Wert einer Wohnung pro Dezibel Lärmsteigerung ein bis eineinhalb Prozent ab. Besonders betroffen sind Drei- und Einzimmerwohnungen.
Grössere Wohnungen mit vier und mehr Zimmern liegen meistens in ruhigeren Wohngegenden. Die Mietzinsausfälle durch den Strassenverkehr belaufen sich jährlich auf 770 Millionen Franken. Der Schienenverkehr verursacht Ausfälle von rund 100 Millionen Franken – also rund siebenmal weniger als der Strassenverkehr. Gesamthaft ist der Verkehrslärm von Schiene und Strasse für Mietzinsausfälle von 874 Millionen Schweizer Franken verantwortlich. Kosten für Schallschutzmassnahmen sind darin nicht enthalten.
Lärm verstärkt auch soziale Probleme. An stark lärmbelasteten Verkehrslagen wohnen häufig zahlungsschwache Menschen: Betagte, Randständige, Alleinerziehende, ausländische Familien. Da die Eigentümer der Liegenschaften weniger Mietzinseinnahmen wegen der lärmigen Lage erzielen, werden solche Liegenschaften oftmals schlecht bewirtschaftet – es werden keine Investitionen getätigt. Eine soziale Entmischung ist die Folge. Wer es sich leisten kann, zügelt in ein ruhigeres Wohnquartier.
Zweifelsfrei gibt es auch an lärmigen Wohnlagen teuren Wohnraum. Hier wurde dann jedoch viel in Lärmschutzmassnahmen investiert (Lüftung, spezielle Verglasung etc.). Gleichzeitig überwiegen an diesen Lagen andere Standortfaktoren, die es attraktiv machen, dort zu wohnen. Eine Studie des BAFU hat gezeigt, dass Mieterinnen und Mieter in Zürich bereit wären, monatlich rund 240 Franken mehr Miete für eine Wohnung mit schwacher Lärmbelastung anstelle der jetzigen stark lärmbelasteten Wohnsituation zu bezahlen.
Steigende Gesundheitskosten
Nicht zu unterschätzen sind die Folgen der Lärmbelastung für die Gesundheit und die Lebensqualität. Lärm wird meist mit Hörschäden in Verbindung gebracht. Dabei hat Lärm auch bereits bei deutlich geringeren Lautstärken Auswirkungen auf die Gesundheit. Jedes Mal, wenn der Körper einem störenden Geräusch ausgesetzt ist, kommt es zur Ausschüttung von Stresshormonen. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt, die Atemfrequenz nimmt zu. Wer ständig unter Lärm leidet, wird mit der Zeit krank, denn der Körper steht unter Dauerstress. Hörschäden, Bluthochdruck, Herzinfarkt oder Schlafstörungen sind die Folge. Auch Konzentrationsstörungen und Stimmungsveränderungen – Depression oder Aggression – können durch Lärm ausgelöst werden. Eine Gewöhnung des Körpers an Lärm gibt es nicht.
Die Lärmkosten für durch Bluthochdruck bedingte Krankheiten und für Herzinfarkt sind bekannt. Die mangelnde Ruhe schlägt pro Jahr mit 124 Millionen Franken zu Buche. Diese Kosten setzen sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen:
- Medizinische Behandlungskosten
- Administrativkosten von Personenversicherungen
- Produktionsausfall: Patienten können vorübergehend oder dauerhaft ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen.
- Vermeidungskosten: Kosten für Massnahmen, um Gesundheitsschäden vorzubeugen wie Freizeitaufenthalten in ruhigen Gebieten, Wechsel des Wohnortes usw.
- Immaterielle Kosten: Verlust an Wohlbefinden, Schmerz und Leid der Patienten und ihrer Angehörigen.
Die grosse Mehrheit der Kosten – 95 Prozent – entfallen auf die immateriellen Kosten (Schmerz und Leid). Zu den Hörschäden, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und psychischen Störungen liegen hingegen keine gesicherten Zahlen vor.
Faktenblatt über die Kosten von Lärm, Bundesamt für Umwelt BAFU
Gewinneinbussen im Tourismus
Lärm vermindert die Lebensqualität. In der Freizeit und in den Ferien streben wir alle eine verbesserte Lebensqualität an, um uns vom Alltag zu erholen. Folglich werden lärmige Gebiete für Freizeit und Ferien gemieden. Dies wiederum führt zu Umsatzausfällen im Tourismus, verminderter Nutzung von Naherholungsgebieten und Lärmfluchtkosten. Es gibt bis heute keine Studien, welche die externen Lärmkosten für Tourismus und Freizeit in der Schweiz berechnen. Abschätzungen zeigen jedoch, dass diese Kosten bis zu 100 Millionen Franken jährlich betragen könnten.
Die Lärmsanierung der Strassen und Eisenbahnen schreitet voran
Seit der Einführung des Umweltschutzgesetztes (1985) wurde bereits 1 Milliarde Franken in die Lärmsanierung von Strassen investiert. Drei Viertel davon entfielen auf Nationalstrassen, ein Viertel auf Haupt- und übrige Strassen. Bisher wurde der grösste Teil der Finanzen dafür verwendet, die Ausbreitung des Lärms zu verhindern. Es wurden hauptsächlich Lärmschutzwände gebaut und Strassen überdacht. Die restlichen Mittel wurden für Ersatzmassnahmen an Gebäuden wie beispielsweise Schallschutzfenster eingesetzt. Bis heute wurde rund ein Viertel der Schweizer Strasse lärmsaniert.
Dank den Volksentscheiden zur Modernisierung der Bahn und zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs vom Herbst 1998 konnte die Lärmsanierung der Eisenbahn in Angriff genommen werden. Insgesamt stehen rund 1,8 Milliarden Franken zur Verfügung. Verbessertes Rollmaterial, Lärmschutzwände und Schallschutzfenster sollen bis 2015 rund 260’000 Personen von übermässigem Eisenbahnlärm befreien. Bis heute kostete die Lärmsanierung der Bahn rund 1 Milliarde Franken.